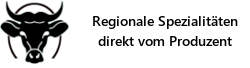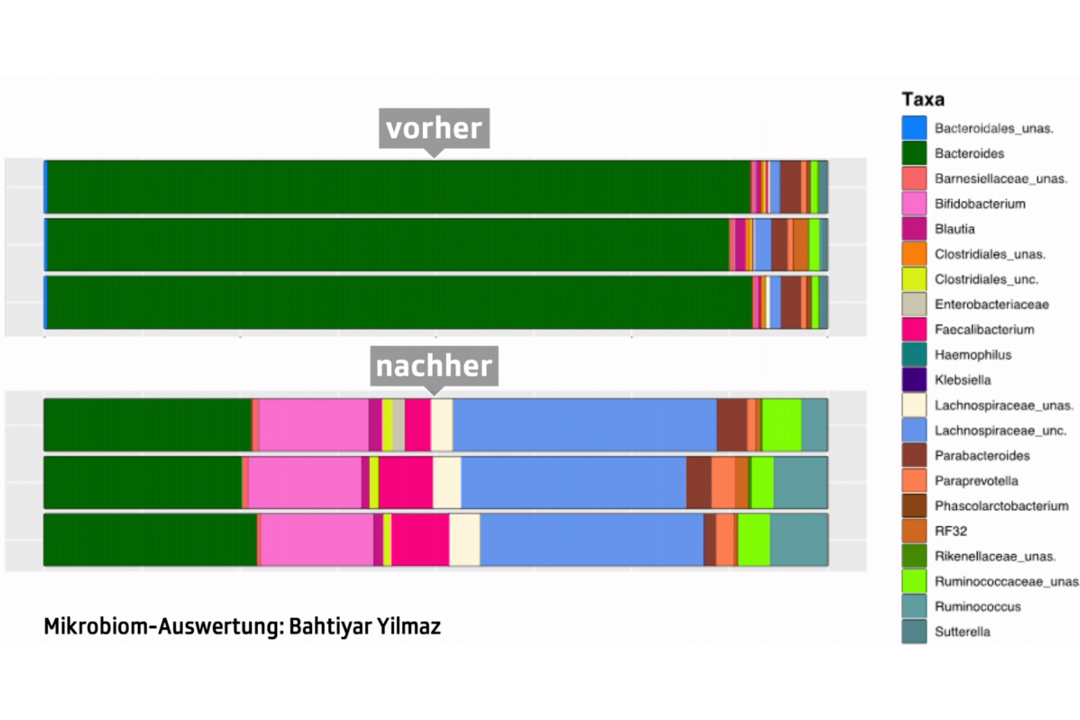Nachhaltig einkaufen im Label-Dschungel
Je näher der Produzent und je kürzer der Transportweg, desto besser die Ökobilanz. Könnte man meinen... So einfach ist es mit der Ökobilanz unserer Lebensmittel nun leider doch nicht. Sonnengereifte Tomaten aus Sizilien können umweltfreundlicher sein als Schweizer Bio-Tomaten. Doch wie kann es sein, dass Bio schädlicher ist als konventionell? Und wie gelingt das nachhaltige Einkaufen?

Der Weg ist das Ziel
Der Frage, wie nachhaltiges Einkaufen geht, haben sich SRF-Espresso und der WWF gewidmet.
Klar ist, dass die Bio-Richtlinien in anderen Ländern weniger streng sind oder schlechter kontrolliert werden als in der Schweiz. Beim Bio-Label der EU sind sogar Flugtransporte erlaubt, was sich entsprechend schlecht auf die Ökobilanz der Lebensmittel auswirkt. Als Konsument hat man also meist keine Chance, die Transportweise herauszufinden. Es gibt keine Deklarationspflicht. Einige Grosshändler wie Migros und Coop kennzeichnen freiwillig das Gestell/Produkt, wenn es per Flugtransport hierher kam. Lidl verzichtet ganz auf den Verkauf von Früchte und Gemüse, das geflogen wurde.

Saison ist Trumpf
Neuseeländische Äpfel und Birnen aus Südafrika sind hier keine Seltenheit. Und manch einer fragt sich, weshalb wir sie vom anderen Ende der Welt hierher transportieren, wenn sie doch auch in der Schweiz wachsen. Verteufeln per se sollte man diese Früchte aber nicht. Je nach Saison haben sie sogar die bessere Ökobilanz als ihre Schweizer Pendants, sofern sie mit dem Schiff transportiert wurden.
Wie kann das sein? Damit die Schweizer Lebensmittel auch nach ihrer Saison im Laden verfügbar sind, müssen sie im Kühlhaus monatelang gelagert werden. Dies kostet natürlich Energie. Und oft sind neuseeländische Plantagen ergiebiger mit mehr Früchten pro Baum.
Fazit: Die Saison ist entscheidend. Wer im Sommer Schweizer Kirschen und im Herbst Schweizer Äpfel kauft, macht alles richtig. Eine Saisontabelle ist hier abrufbar.

So kauft's sich nachhaltig
Was ich gelernt habe: Bio ist nicht gleich Bio, Neuseeland ist nicht per se schlecht und frisch geerntete Lebensmittel aus der Region sind nicht nur am nährstoffreichsten, sondern haben auch die beste Ökobilanz.
Und so kann es gut sein, dass ein konventionell angebauter Apfel eine bessere Ökobilanz hat als ein Bio-Apfel vom Ausland, der allenfalls noch per Flugzeug hierher kam.
Gleichzeitig frage ich mich, ob wir wirklich das ganze Jahr über dasselbe Sortiment brauchen. Würden wir unseren Konsum wieder mehr nach der Saisonalität richten, hätten wir automatisch gesündere und umweltfreundlichere Lebensmittel. Aber dies bedingt natürlich auch einen gewissen Verzicht.
Weitere Informationen: